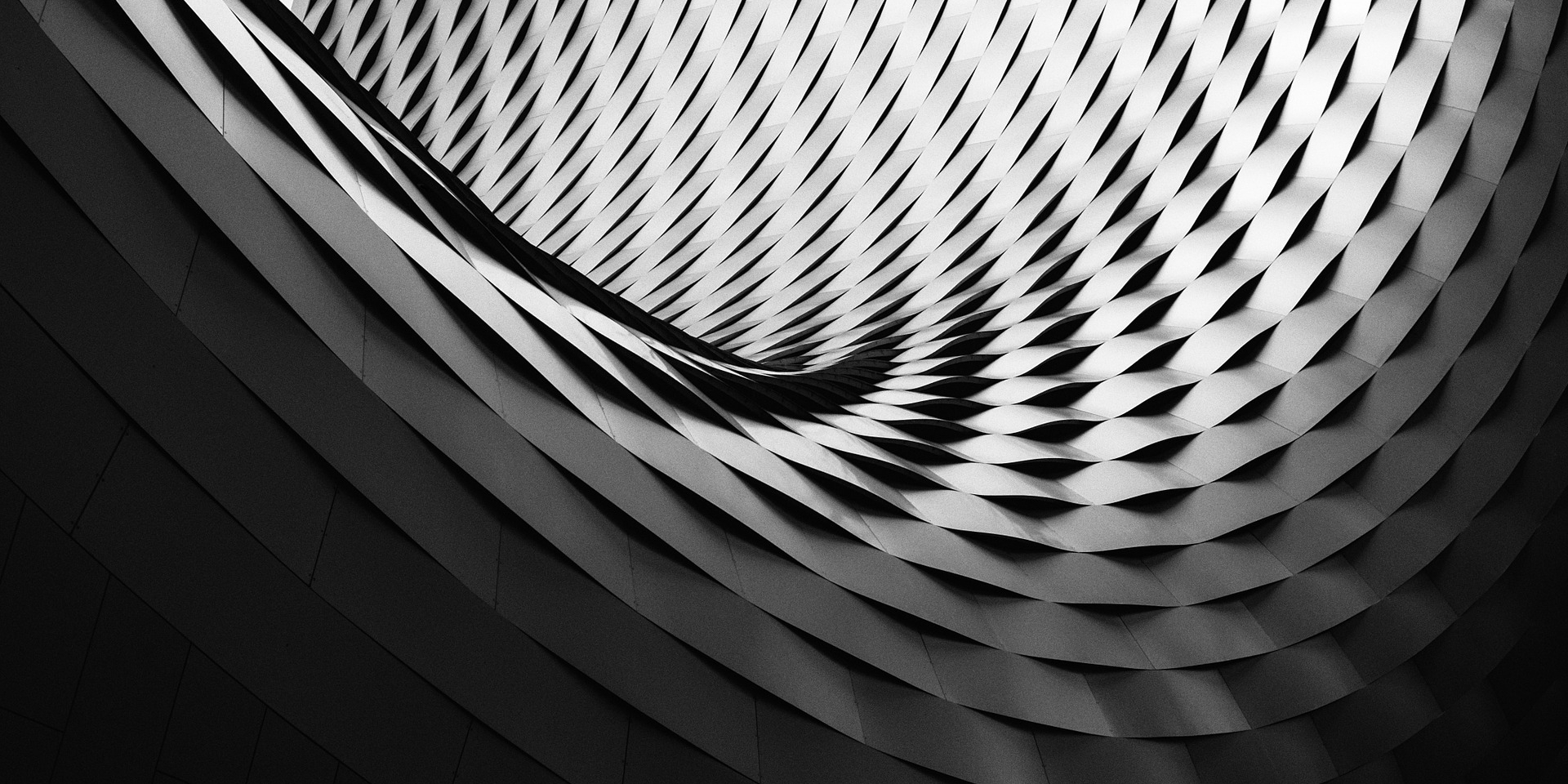In Friedenszeiten ist sonntags ganz Wien auf den Beinen. Man unternimmt in der schönen Jahreszeit Spazierfahrten und Landpartien.
Das geht mit dem Zeiselwagen – ein einfaches Leitergefährt für mehrere Personen, das einen bis zur Stadtgrenze bringt.
Die Lobau mit dem Schlachtfeld von 1809 gilt als besonders beliebtes Ausflugsziel. Von 1812 an verkehrt dann regelmässig ein Stellwagen vom Zentrum nach Heiligenstadt – das ist ein Gesellschaftsgefährt mit Überdachung.
Metternich gelingt es am Wiener Kongress 1815 »Legitimität« als das Prinzip internationaler Beziehungen zu etablieren. Eine Sache muss am Papier rechts sein, um als gerechtfertigt zu gelten.
Dieser Grundsatz zementiert allerdings die Monarchie und dient der Unterdrückung des Nationalismus. Die Habsburgerkaiser sahen sich ja immer schon in einem höheren Recht, das Gottesgnadentum ist ein Grundrequisit ihrer Herrschaft. »Der Tyrann«, sagen sie sich, »befreit jeden einzelnen von der Tyrannei des Nachbarn«. Das freilich geschieht jetzt zunehmend durch den vormärzliche Polizeistaat und wird durch den Einsatz von Vernaderern und Spitzeln perfektioniert.
Charles Sealsfield, alias Karl Postl, vergleicht das Habsburgerregime mit der Tyrannei Napoleons. »Die Willkür des franziszeischen Regierungssytems« beruht für diesen Kritiker auf einer raffiniert-grausamen Mixtur: »wirkliche Einfachheit, despotischer Hochmut, wahrhaft jesuitische Verschlagenheit, gespielte Offenherzigkeit, rohester und undankbarer Egoismus und scheinbar gütige Nachsicht wohnen in dieser Fürstenseele enge nebeneinander«.
»Despotischer Hochmut«, »rohester Egoismus« – haben wir richtig lesen? Einer Zeit, die den Habsburgermythos täglich als touristische Goldader vermarktet, müssen solche Wort abstossend fremd erscheinen. Der Leichnam des Reiches ruht heute, gut einbalsamiert, in der Kapuzinergruft; dass er einmal Anlass zum Leiden war, Ursache bitterer Zeiten – vergessen.
Umso eiliger trieb es damals die WienerInnen ins Grüne hinaus. 1819 und 1822 entstehen in Meidling, 1832 in Atzgersdorf gern besuchte Bäder. Die Wohlhabenden errichten an den verkehrsgüstig gelegenen Stadtgrenzen die ersten Villen: also in Währing und Hietzing, in den 1830er-Jahren folgen Mauer und Rodaun.
Unter dem Eindruck der Pariser Julirevolution 1830 weist Polizeidirektor Johann Baptist Freiherr Waldstätten auf das bekannte »Phlegma« des Österreichs hin, auf sein »kindliches Gemüt« und das »lebhafte Gefühl des Gehorsams und Subordination«. Ohne Zweideutigkeit lobt der Ordnungsmann die »ungefärbte, naturwüchsige, unmittelbar aus tiefer Brust hervorquellende Loyalität«, die »patriotische Freudigkeit unverdorbener Kernnaturen«.
»Stadt der Cäsaren!«, antwortet ein Spaziergänger laut lachend auf dem Kobenzl: »deine ganze Grösse leicht bedeckt von meiner Hand«. Dieser schlimme Finger ist der Dichter Anastasius Grün, als Poet ein absoluter Fachmann für Zukunftsinteressen; er weiss bereits, dass es keinesfalls bleiben kann, wie es ist.
Das betrifft den Hunger, das Elend und die gefesselte Stadt.
Beginnen wir mit der Stadt: Die Rolle, die die Vertreter Wiens und der 18 mitleidenden Städte und Märkte auf den Landesversammlungen spielten, ist von einer nicht mehr zu überbietenden Kläglichkeit: Stehend haben die Ratsherren der Verlesung der »Postulate«, sprich: der Steuerforderungen der Regierung, beizuwohnen. Dann müssen diese Notablen den Sitzungssaal verlassen und sind von der mündlichen Erörterung der Vorlagen ausgeschlossen. Die Vertreter des Volkes dürfen nur noch eine schriftliche Stellungnahme zum Ergebnis einreichen.
Nicht nur Johann Nepomuk Nestroys, dieser gewissenlose Leugner eines gottgewollt-gnädigen Schicksals, unternimmt den Versuch, etwas gegen die Lage zu unternehmen. Die innerhalb eines Jahrzehnts perfektionierte Zensur bringt eine spezifische Art des Doppelsprechens hervor.
Die Kultur bewohnt eben nicht nur adelige Stammsitze, sie ist im 19. Jahrhundert vor allem Stadtkultur geworden, kreative Nachahmung und raffinierte Verstellung. Gemeint ist selten das, was gesagt wird. Man spricht nicht unbedingt aus, was man im Innersten meint. Doderer wird diese Windigkeit des Wieners abschätzig den Urschleim der Stadt nennen. Tatsächlich vervielfacht sich unter dem Druck der Zensur das süsse Gift der Urbanität.
1835 reisen die Wienbewohner nach Döbling, wegen seiner Nähe zum »reizenden Gebirge«. Aus Vergnügungsfahrten und Sommeraufenthalten werden Sommerdomizile. Grosshändler, Fabrikanten und hohe Beamten sind die ersten, die sich hier privat Residenzen errichten lassen. Mit bürgerlich-repräsentativer Vorderfront und mit Obstgarten oder kleinem Park nach hinten hinaus. Begeistert werden Saletteln, Grotten und Teiche angelegt, begabt bunte Akzente im Garten verteilt. So wächst bereits etwas Grünes in die Schwarze Zeit hinein.
Nicht dass das Land direkt fortschrittsfeindlich wäre, nein. Altösterreich liegt bei der Einführung der Eisenbahn 1838 an neunter Stelle. Und das persönliche Leben lässt sich ja nicht mehr abschaffen wie der polnische Reichstag. Aber der einzige aus Bürgern gebildete städtische Vertretungskörper ist ein Witz, eine Karikatur von Demokratie und Mitbestimmung.
Das machtlose Gremium heisst äusserer Rat. Es bietet ein Zerrbild von reichshaupstädtlichen Ansprüchen. Die korpulenten und geilen Ratsherren werden im Volksmund als »Ja-ja-Manderln« verhöhnt.
Erst unter Ignaz Czapkas Bürgermeisterschaft (1838-48) gibt die Wiener Stadtverwaltung wieder Lebenszeichen von sich. Es regt sich der Wille, die Angst vor dem Adel zu ersticken, es verstärkt sich die Neigung zu selbstständigen Entschlüssen. Wieder kommt der alte Gärungsprozess in Gang.
Doch noch bleibt es bei einem vielfachen Gegen- und Nebeneinander magistratischer und herrschaftlicher Zuständigkeiten. Die listige Obrigkeit verfügt, und die anspruchsvollen Bürger verfügen ihrerseits, keiner wendet sich entgültig dem Licht zu. Nein, auch Czapka ist nicht der Mann, die engen Grenzen einer rein landesherrlichen Verwaltungstelle des Bürgermeisteramts zu sprengen.
© Wolfgang Koch 2007
next: MO